Es war einmal vor langer Zeit (1969 bis 1995), da war Rubaga (wie es zu der Zeit hieß) das Ziel, die Herausforderung und ein wunderbares Geschenk für mich. Obwohl Jahrzehnte zwischen dem Einsatz damals und dem Leben heute liegen, so ist das Bild von Land, Leuten, Aufgaben, Situationen und Menschen noch sehr lebendig geprägt von der Erinnerung und dem Hintergrundwissen (Anm.: Christa Werner arbeite 24 Jahre in der Pflege in Rubaga, zuletzt als Pflegedienstleitung, und unterstützte während dieser Zeit Dr. Dr. Rita Moser aus Stuttgart, die „Medical Superintendent“ des Hospitals).
Permanenter Kontakt, Besuche in Abständen, das Teil sein bei Ereignissen und Plänen haben wohl den Anschluss der Entwicklung und des Wachstums vermittelt, und doch liegt immer der Vergleich nahe von damals und heute. Berichte wie bei der Jahresversammlung des Fördervereins 2021 lassen diese Memoiren sofort erwachen.
Auch wenn von Mal zu Mal weniger lautstarke Begrüßungen bei der Hospital-Tour zu hören sind und überschwänglicher Jubel heute von Schülerinnen stammt, die ich in der Babyklasse des Kindergartens kennenlernte – die Wurzeln, die Liebe zu Uganda und den Freunden sind ebenso lebendig wie die Sorge um das damals sehr familiär aufgebaute Hospital, mit allen Kriegs- und Versorgungsnöten, mit Unsicherheit und Angriffen, mit unsagbaren persönlichen Nöten der Mitarbeiter, Innlandflüchtlingen zu hunderten, der AIDS-Epidemie und der Freude eines zusammengeschweißten Teams, das sich gegenseitig trug.
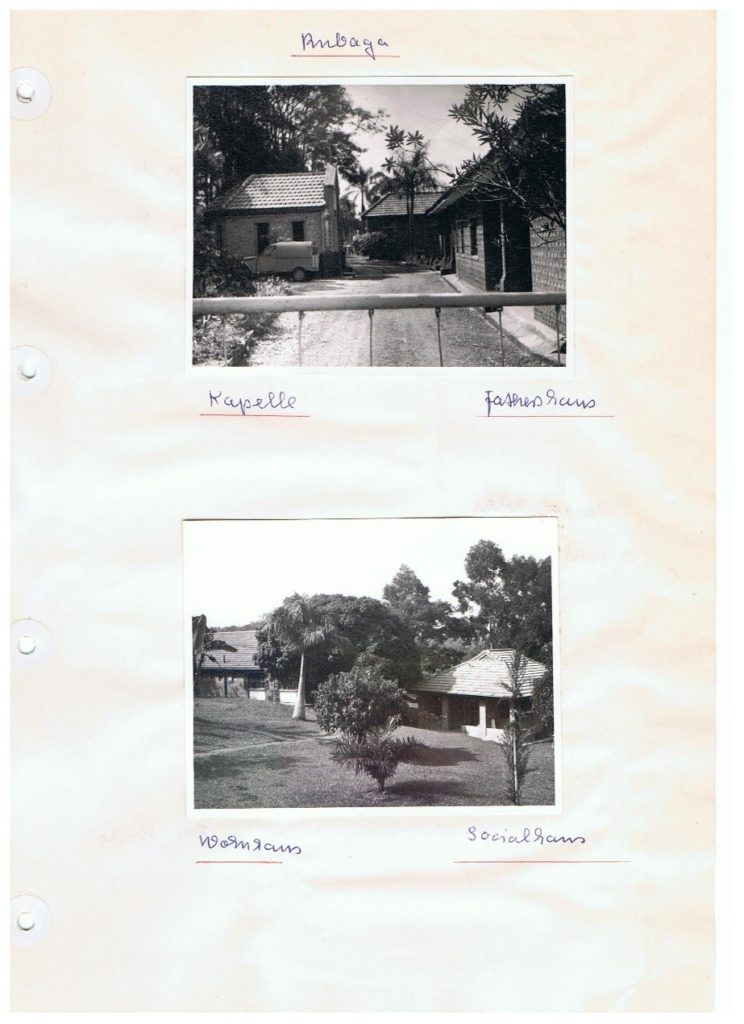

Es hat sich so Vieles verbessert: Gebäude, Gesundheitsdienste, Diagnostik, Personal, Fachkliniken. Die unsagbare Patientenflut der Nachkriegszeit, die uns damals ein Tagespensum von 1.200 Menschen in die Ambulanz spülte – hat sich verringert. Spezialisten sind Teil des Teams, und die Technik wurde, dank vieler engagierter Menschen auch aus den Reihen der „Freunde von Lubaga“ und von „Partnerschaft Gesunde Welt“ unsagbar verbessert. Wenn ich nur an Wasser und Stromversorgung früherer Jahre denke – und heute die Pumpen- und Solaranlagen funktionieren, bin ich einfach nur dankbar.
Freilich, ein Hospital am Äquator, in einem Land, in dem die Schere zwischen arm und reich gewaltig auseinanderklafft und Infektionen schon durch das Klima und die sanitären Verhältnisse vorprogrammiert sind, wird immer ein Fass ohne Boden sein.
So ist jetzt die Pandemie eine große Not, da Abstand unmöglich, Impfungen und Teststationen rar und die vielen Taglöhner in der Stadt ohne Arbeit und daher mittellos sind. Familien, die hungern, Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen dürfen, Transport der gedrosselt ist, auch die Versorgung lahmlegt, schaffen Situationen, die entmutigen. Die Menschen vertrauen in solcher Zeit auf Gott und schauen auf Freunde in Übersee und alle Personen in Leitungsfunktionen. Wenn dann, wie jetzt am Karsamstag, der Erzbischof tot im Bett gefunden wird, dann ist die Verzweiflung groß und die Gerüchteküche brodelt.
Auch die Klimaveränderung gibt Rätsel und Nöte auf: Trockenperioden, aggressive Stürme und Überschwemmungen vernichten Ernten. Wasserspendendes „Ewiges“ Eis und Schnee auf den fünftausender Gipfeln des Rwenzori, wie Herr W. Fischer in seinem Bericht gezeigt hat, erweist sich als vergänglich und gibt Anlass zu Spekulationen über Trinkwasser und Versandung.

Rwenzori vor 40 Jahren 
Rwenzori heute
Abschlüsse von Schüler/Innen und Studenten, unterstützt und gefördert von Spendern hier sind eine unglaubliche Zukunftsinvestition. Sie sind es, die in den kommenden Jahren den Aufbau des Landes in die Hand nehmen werden und für eine neue Qualität des Lebens und der Sorge füreinander stehen. Wir dürfen stolz auf unseren Dienst sein und einander danken.



